
„Die Vereinbarung zwischen den Forschungseinrichtungen und Oerlikon ist ein wegweisendes Kooperationsmodell zwischen Wissenschaft und Industrie", sagt Oerlikon CEO Dr. Uwe Krüger. „Wir bringen hier die Spitzenforschung zweier weltweit renommierter Institute mit unserem industriell führenden Engineering Know-how in der Oberflächentechnik zusammen", so Krüger. Universitätspräsident Prof. Rudolf Steinberg dankte den Stiftern und hob hervor: „Dass sich ausländische Stifter an der Goethe-Universität engagieren, ist bislang noch eine Seltenheit. Das Engagement der OC Oerlikon in unserem Fachbereich Physik zeigt aber, dass die Goethe-Universität durchaus auch über die Grenzen Deutschlands hinaus als attraktiver Kooperationspartner wahrgenommen wird. Dies sollte anderen möglichen Kooperationspartnern eine Ermunterung für eigenes Engagement sein." Die Stiftungs-Professur entspricht einer W2-Dotierung, ist auf fünf Jahre befristet und wird mit 400.000 Euro unterstützt. Das offizielle Berufungsverfahren wurde vergangene Woche gestartet.
Terahertzstrahlen bewegen sich in einem Grenzbereich, den Hochfrequenz-Empfänger fast nicht mehr, optische Sensoren aber noch nicht abdecken. Terahertzstrahlung durchdringt viele Materialien, wirkt jedoch aufgrund der geringen Energie ihrer Photonen - im Bereich von wenigen Milli-Elektronenvolt - nicht ionisierend. Damit ist theoretisch eine Vielfalt industriell und wirtschaftlich höchst interessanter Anwendungen denkbar, etwa in der Oberflächenanalyse und Qualitätssicherung bei der Produktion von Solarpanels, Textilen und Kunststoffteilen oder bei der Durchleuchtung von Verpackungen. Aufgrund der Verwandtschaft mit Radar sind Anwendungen wie die dreidimensionale Bildgebung denkbar. Bislang stehen jedoch keine kompakten und kostengünstigen Sender mit ausreichender Ausgangsleistung zur Verfügung, wie sie für niedrigere Frequenzen im Mikrowellenbereich oder höhere Frequenzen im Infrarotbereich vorhanden sind. Auch die Empfängertechnik bedarf weiterer Entwicklung, um mit empfindlicheren Empfängern noch schwächere Signale aufspüren zu können.
Genau hier soll die „Goethe-Leibniz-Oerlikon-Nachwuchsprofessur für THz-Photonik" - so der offizielle Titel - ansetzen. Am Physikalischen Institut der Goethe-Universtität bietet das Umfeld der Arbeitsgruppe „Ultrakurzzeitspektroskopie und Terahertz-Physik", geleitet von Prof. Dr. Hartmut Roskos, beste Voraussetzungen, dieses Themenfeld wissenschaftlich zu erschließen. „Wir befassen uns seit langem mit grundlegenden Fragen, die zur Verbesserung der THz-Technologie beitragen, und haben stets auch mögliche Anwendungen verfolgt. In beiden Richtungen werden wir durch die Stiftungsprofessur erheblich gestärkt", erläutert Roskos. Die Universität Frankfurt stellt für die Professur, die mit der Funktion eines Bereichsleiters am Ferdinand-Braun-Institut verbunden ist, Räumlichkeiten und Lehrmittel zur Verfügung.
Das Ferdinand-Braun-Institut, ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft, ist eine der weltweit führenden Einrichtungen für anwendungsorientierte und industrienahe Forschung in der Mikrowellentechnik und Optoelektronik. Im Rahmen der Kooperation baut das FBH seine Aktivitäten im Bereich Terahertz-Anwendungen weiter aus - die Stiftungs-Professur ist mit der Leitung des neuen Geschäftsbereichs Terahertz-Photonik am FBH verbunden. „Das ist für uns bereits die dritte Kooperation dieser Art und Teil unserer strategischen Ausrichtung", erläutert Prof. Dr. Günther Tränkle, Direktor des Berliner Instituts, die Zusammenarbeit. „So vernetzen wir exzellente Wissenschaftler renommierter Hochschulen mit unserer Expertise beim Technologietransfer und der Umsetzung in industriell nutzbare Anwendungen", ergänzt Tränkle. Der Präsident der Leibniz- Gemeinschaft, Prof. Ernst Th. Rietschel, lobt die Initiative: „Das ist ein wegweisendes Kooperationsmodell für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie." Diese Art der Nachwuchsprofessur passe überdies ausgezeichnet zur jüngst etablierten Leibniz-Humboldt- Professur, sagt Ernst Rietschel weiter.
Im Rahmen eines dezentral organisierten, vernetzten Innovationsmanagements kommt der Zusammenarbeit mit den zwei weltweit führenden Forschungseinrichtungen Beispielcharakter zu. „Die Zeit einer zentral ausgerichteten Forschung und Entwicklung ist vorbei", betont Dr. Andreas Widl, Executive Vice President R&D und bei Oerlikon für die konzernübergreifende Koordination der Forschung und Entwicklung verantwortlich. Dafür seien die Themengebiete heute zu komplex, entwickelten sich zu schnell und benötigten für ihre Erforschung immer höhere Aufwendungen in Laborgeräte. „Wir setzen deshalb auf die Vernetzung mit der Spitzenforschung und gehen mit ausgewählten Einrichtungen gezielte Kooperationen ein", so Widl. Schon in der Vergangenheit hat sich dieser Ansatz bewährt. Der Durchbruch in der Dünnschicht-Silizium-Technik, den Oerlikon Solar zurzeit verzeichnet, wurde auch durch die Grundlagenforschung an dem Institut für Mikrotechnik an der Universtität Neuchâtel ermöglicht - ebenfalls ein enger Kooperationspartner von Oerlikon.
Um solche Erfolge künftig systematischer zu erzielen, hat der Oerlikon Konzern sein Innovationsmanagement zu Beginn 2008 neu ausgerichtet. Anfang des Jahres gründete das Unternehmen ein Scientific Advisory Board (SAB), dem fünf renommierte Forscher angehören und das Oerlikon in wissenschaftlich-technischen Fragen und Zukunftspotenzialen neuer Technologien beratend zu Seite steht. „Innovationen sind der Schlüssel für unsere weitere Unternehmensentwicklung", sagt Oerlikon CEO Krüger, selbst promovierter Physiker: „Wir müssen jetzt die Projekte auf den Weg bringen, mit denen wir in fünf Jahren Erfolge wie in der Solartechnik wiederholen".
Oerlikon ist ein globales Innovationskraftzentrum für Oberflächentechnik, Polymerverarbeitung und additive Fertigung. Unsere Lösungen und umfassenden Dienstleistungen verbessern und maximieren zusammen mit unseren fortschrittlichen Werkstoffen die Leistung, Funktion, das Design und die Nachhaltigkeit der Produkte und Fertigungsprozesse unserer Kunden und deren Kunden in Schlüsselindustrien. Mit mehr als 12 600 Mitarbeitenden an 207 Standorten in 38 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,6 Milliarden CHF und engagiert sich weiterhin für die industrielle Transformation für eine nachhaltige Zukunft.
| OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon (Firmenporträt) | |
| Artikel 'Oerlikon stiftet Nachwuchsprofessur für Terahertz-Photonik...' auf Swiss-Press.com |
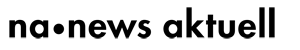

Organspende im Aufwärtstrend - trotz mehr Ablehnungen
Swisstransplant, 02.05.2025Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte im Zeitalter von KI und Social Media
Medicus Mundi Switzerland, 02.05.2025
17:02 Uhr 
«Metzger sagt man nicht mehr» »
17:01 Uhr 
«Schlechter informiert als ein Grundschüler»: Die Wut eines ... »
15:21 Uhr 
Armeeangehöriger bei Unfall auf Simplonpass schwer verletzt »
11:42 Uhr 
Neue Arbeitswelt: Von wegen zu Hause arbeiten ade: Immer mehr ... »
A. Vogel Bio Herbamare 3x10g
CHF 4.35
Coop

A. Vogel Bio Kelpamare
CHF 4.85
Coop

A.Vogel Bio Herbamare Kräutersalz
CHF 4.75
Coop

A.Vogel Bio Herbamare Kräutersalz
CHF 3.40
Coop

A.Vogel Bio Herbamare Kräutersalz
CHF 14.90
Coop

A.Vogel Bio Herbamare Kräutersalz Spicy
CHF 6.45
Coop

Aktueller Jackpot: CHF 2'037'698